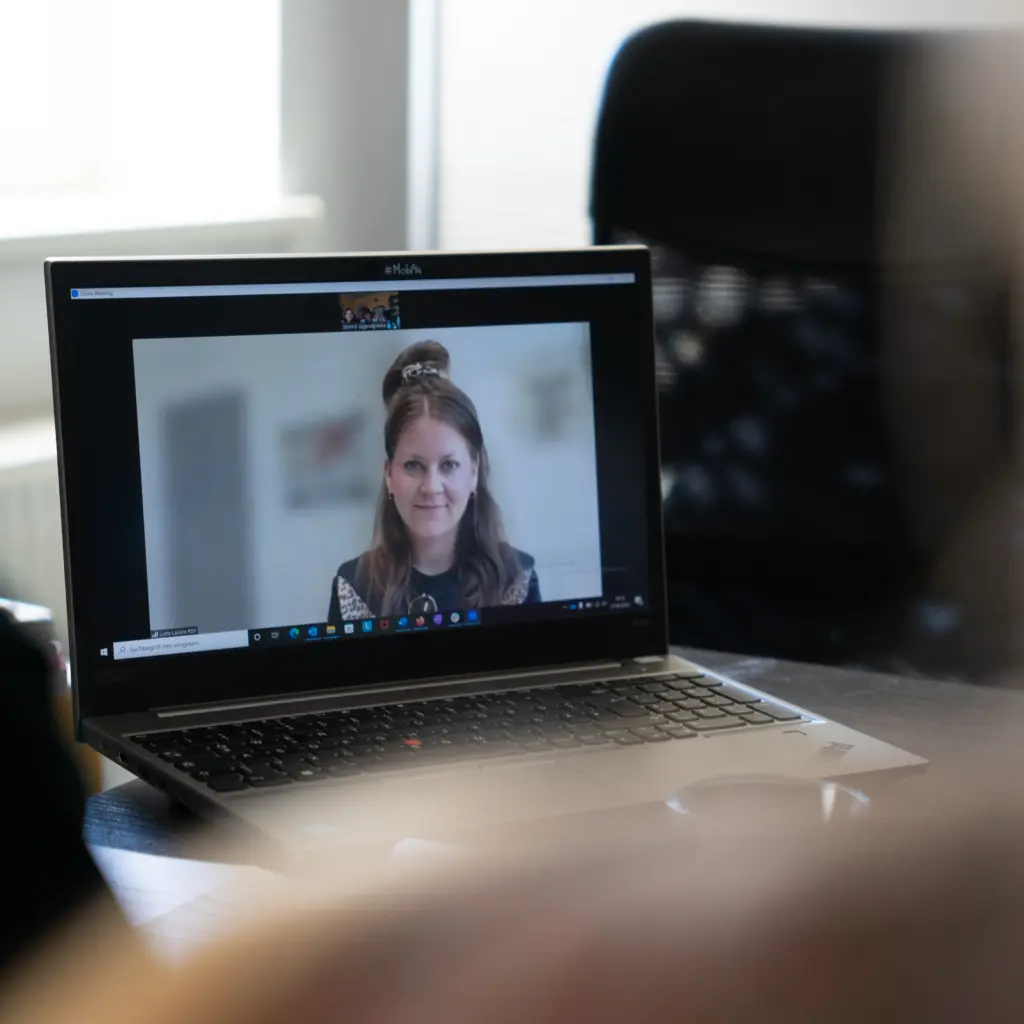Gabriel Geis blickt im Interview mit politikorange-Redakteur Raphael Fröhlich auf die Atmosphäre der deutschen Nachkriegsgesellschaft zurück und erzählt, warum er sein gesamtes Leben umkrempelte.
politikorange: Können Sie sich kurz vorstellen?
Gabriel Geis: Ich bin 1950 in Amsterdam geboren. Meine Eltern sind dann nach einer Odyssee wegen des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1952 nach Deutschland zurückgekehrt. In Düsseldorf machte ich Abitur und zog nach Hamburg. Der politische Aufbruch meiner Generation und die internationale Solidarität wurden meine neue Identifikation als Alternative zum jüdischen Elternhaus.
In welchen Berufen arbeiteten Sie?
Ich arbeitete für sieben Jahre im Hamburger Hafen als Kaiarbeiter. Während dieser Zeit war ich immer politisch aktiv und engagierte mich im Betriebsrat. Ich geriet dann in eine Art Sinnkrise und begann, die kommunistische Richtung in Frage zu stellen. Nach und nach krempelte ich zum zweiten Mal mein Leben wieder um und aus dieser Veränderung heraus fing ich an, Psychologie zu studieren. Meine Diplomarbeit verfasste ich über die Identität nach 1945 geborener Juden in Deutschland.
Gibt es Gefühle oder Erlebnisse, die Ihnen aus Ihrer Kindheit besonders in Erinnerung sind?
Ja, da war das „Erbe“ meines Vaters, der in Buchenwald im Konzentrationslager war und dann auf den letzten Drücker nach Palästina entkommen ist. Er gehörte zu den wenigen Juden, die nach dem Krieg nach Deutschland zurück wollten. Das war sehr ambivalent, weil das, was er sich da vorgestellt hatte – nachdem nun die Nazis weg waren und was man dort alles machen könnte – war letztendlich gar nicht so.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich in der Grundschulzeit jemand diskriminierte. Trotzdem herrschte eine Atmosphäre, in der man vorsichtig war. Wenn man vor die Haustür trat, konnte ja jeder in der Generation meiner Eltern ein Mörder sein, der zum Beispiel meine Tante umgebracht hat, die in Auschwitz getötet wurde. All das spielte im Hintergrund mit und bestimmte auch meine Rolle in der Familie.
Was hat sich in Ihrer Jugend verändert?
Ich hatte relativ schnell das Gymnasium gewechselt, da die Atmosphäre nicht gut war. Ein Urerlebnis für mich war die Beschäftigung mit der Junta in Griechenland im Jahr 1967. Von der Geschichte war ich total nervlich und psychisch belastet. Ich hielt ein Referat darüber. Aus der Klasse kam überhaupt kein Interesse. Ich war sowas von isoliert. Das war nicht Antisemitismus, aber totale Ignoranz und fehlende Sensibilität.
Wenn Sie an Selbstfindung in ihrer Jugendzeit, aber auch an die Berufswahl denken: Welche Herausforderungen spielten bei Ihnen eine Rolle?
Zur Familie und speziell zu meinem Vater hatte ich einerseits ein enges Verhältnis. Er war sehr freundschaftlich, konnte sehr lustig sein. Auf der anderen Seite war es eine riesige Belastung für mich. Mein Vater ist jede Nacht schreiend aus Albträumen aufgewacht. Meine Mutter und meine Schwester haben weitergeschlafen – als kleines Kind habe ich meinen Vater dann begleitet.
Sind Ihnen solche Vorfälle in der Zeit öfter aufgefallen?
Solche Vorfälle waren bei jüdischen Familien in der Zeit normal, meist hatten diese sich dann in die jüdische Gemeinde zurückgezogen und sind unter sich geblieben. Meine Eltern waren da eine Ausnahme. Auch in Jugendgruppen in jüdischen Gemeinden war ich nicht. Meine Freunde habe ich dann außerhalb von jüdischen Kreisen gesucht. Mehr und mehr habe ich mich von dem abgekehrt, was meinen Eltern besonders wichtig war.
Hat sich Ihre Definition von Identität über die Jahre verändert?
Das ging immer wieder auf und ab. Nach der erwähnten Sinnkrise, sortierte ich mich völlig neu und entdeckte auch mein Judentum wieder. Das hieß erstmal dort anzuknüpfen, wo ich ausgestiegen war – und ausgestiegen bin ich, weil das alles mit dem Dritten Reich zu tun hatte.
Wie lief der Identitätsfindungsprozess dann weiter?
Ich habe angefangen, mir die Frage zu stellen: Was ist eigentlich meine Identifikation mit dem Judentum? Nicht nur im negativen Sinne, sondern positiv. Und da habe ich Jahre gebraucht. (Seine Stimme bricht, die Emotionen kommen hoch.) Im Rahmen meines Psychologie-Studiums habe ich mich mit der Werte-Analyse beschäftigt, also mit den Werten, die für mich am wichtigsten sind. Da sind zwei Werte herausgekommen: Autonomie und Zugehörigkeiten. Zum Beispiel Kampfsport, Judentum mit meiner Definition, aber auch mit der jüdischen Gemeinde und Israel; als Vater, als Ehemann. Das ist mein persönlicher Mix, der über viele Jahre gewachsen ist und mit dem ich mich heute gut fühle.